Международное название:
Синонимы:
Характеристики:
| Сложность: | |
| Цикл развития: | |
| Световой режим: | |
| Режим полива: | |
| Температура: | |
| Почва: | |
| Ключевая черта: |
Цвет листвы
Цвет бутонов
Размеры цветка
Систематика:
| Домен: | |
| Царство: | |
| Отдел: | |
| Класс: | |
| Порядок: | |
| Семейство: | |
| Род: |
Die Landwirtschaft verändert sich rasant. Was früher mühsame, papierbasierte Aufzeichnungen und Bauchgefühl war, ist heute eine datengetriebene Angelegenheit: Sensoren messen Bodenfeuchte, Drohnen liefern Ertragskarten, und Farm-Management-Software verknüpft alle Informationen zu handlungsfähigen Empfehlungen. In diesem Artikel nehme ich Sie mit auf eine ausführliche, praxisnahe Reise durch die Welt der digitalen Landwirtschaft und vergleiche die wichtigsten Farm-Management-Softwarelösungen. Dabei betrachte ich nicht nur technische Features wie IoT-Integration, Cloud-Architektur oder GIS-Funktionalität, sondern auch wirtschaftliche und organisatorische Aspekte wie ROI, Datensicherheit und Schulungsaufwand. Ziel ist, dass Sie nach der Lektüre eine klare Vorstellung haben, welche Software zu Ihrem Betrieb, Ihrer Betriebsgröße und Ihrer Strategie — ob precision farming, Nachhaltigkeit oder betriebswirtschaftliche Optimierung — passt.
- Warum digitale Landwirtschaft? Chancen und Treiber
- Was ist Farm-Management-Software? Ein Überblick über Funktionen und Architektur
- Kernfunktionen moderner Farm-Management-Software
- Marktüberblick: Wer bietet Farm-Management-Software an?
- Vergleich beliebter Farm-Management-Software
- Auswahlkriterien: Wie wählt man die richtige Lösung?
- Implementierung: Schritt-für-Schritt zur produktiven Nutzung
- Finanzen: Wirtschaftlichkeit und Return on Investment (ROI)
- Datenschutz und Datensicherheit: Wer besitzt die Daten?
- Praxisbeispiele: Wie Betriebe digitale Lösungen nutzen
- Zukunftstrends: Was kommt als Nächstes?
- Praktische Tipps für Betriebsleiter: So holen Sie das Maximum heraus
- Herausforderungen und Risiken
- Checkliste: 10 Fragen vor der Entscheidung
- Praxis-Check: Ein kleines Beispielprojekt für Ihren Betrieb
- Ressourcen und Weiterbildung
- Schlussfolgerung
Warum digitale Landwirtschaft? Chancen und Treiber
Die Gründe, warum Landwirtinnen und Landwirte zunehmend auf digitale Lösungen setzen, sind vielfältig. Zunächst ermöglicht die Digitalisierung eine viel bessere Entscheidungsgrundlage: Ertragskarten, Bodenanalysen und Wetterdaten werden kombiniert, um gezielte Düngung, präzise Bewässerung oder optimale Pflanzzeiten umzusetzen. Precision Farming erhöht so die Flächeneffizienz, reduziert Ressourceneinsatz und steigert die Rentabilität. In Zeiten volatiler Märkte und steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit sind diese Vorteile entscheidend.
Ein weiterer Treiber ist Personal- und Zeitmangel. Automatisierte Dokumentation, digitale Betriebsführung und mobile Apps sparen Arbeitszeit und reduzieren Fehler beim Reporting — etwa bei Pflanzenschutzaufzeichnungen oder bei der Verwaltung von Maschinenstunden. Darüber hinaus fordern gesetzliche Vorschriften und Zertifizierungsprogramme immer detailliertere Nachweise; digitale Systeme erleichtern die Compliance. Schließlich eröffnet die Vernetzung mit Lieferketten und Agrarhandelsplattformen neue Absatzchancen und Transparenz bis zurück zum Verbraucher.
Digitale Landwirtschaft ist zudem kein reines Technikversprechen: Sie ist ein kultureller Wandel. Sie erfordert eine neue Art des Denkens im Betrieb, Weiterbildung und oft eine Anpassung des Betriebsmanagements. Wenn dieser Wandel gelingt, stärkt er die Resilienz des Betriebs gegenüber Klimaschwankungen, Marktunsicherheiten und regulatorischen Anforderungen.
Was ist Farm-Management-Software? Ein Überblick über Funktionen und Architektur
Farm-Management-Software (FMS) ist ein Sammelbegriff für digitale Plattformen, die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführen und Landwirtinnen und Landwirten ermöglichen, Betrieb, Produktion, Maschinen und Finanzen zentral zu steuern. Typische Kernbausteine sind Flächenmanagement, Einsatzplanung, Maschinen- und Lagerverwaltung, Dünge- und Pflanzenschutzplanung, Ertragskartierung sowie Betriebswirtschafts- und Controlling-Module.
Die Architektur moderner Lösungen beruht oft auf Cloud-Services, mobile Apps und offenen Schnittstellen (APIs) für die Integration von Telematik, IoT-Sensoren, Drohnen und externen Datenquellen wie Wetterdiensten oder Bodenanalyselaboren. GIS (Geoinformationssysteme) ermöglichen die Kartenansicht von Feldgrenzen, Parzellen und Variabilitätszonen. KI-gestützte Module analysieren historische und Echtzeitdaten, um Empfehlungen zu erzeugen — von variabler Aussaat bis zu prädiktiver Wartung für Maschinen.
Wichtig ist die Rolle des Datenmanagements: Gute FMS vereinen Rohdaten, aufbereiten sie und liefern dashboards und Berichte, die wirtschaftliche Entscheidungen unterstützen. Funktionen wie Zugriffsrechte, Audit-Trails und Backup sind in Zeiten sensibler Betriebsdaten unerlässlich.
Kernfunktionen moderner Farm-Management-Software
Die Bandbreite an Funktionen ist groß — doch einige Module sind für die meisten Betriebe besonders relevant. Im Folgenden liste ich die wichtigsten Funktionen und erläutere, warum sie praktisch sind und worauf es bei der Bewertung ankommt.
– Feld- und Flächenmanagement: Digitale Parzellendaten, Kartenimport, Flächengrenzen, Historie von Fruchtfolgen. Diese Basisfunktion ist essenziell für Analyse und Planung.
– Einsatzplanung: Planung von Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz, Ernte inklusive Material- und Personalbedarf. Hilft, Abläufe zu optimieren und Kosten zu senken.
– Maschinen- und Telematik-Integration: Verbrauchs- und Betriebsdaten, Maschinenstandorte, Remote-Diagnose. Wichtig für Wartungsplanung und Betriebskostenkontrolle.
– Ertragskartierung und GIS-Analyse: Ertragskarten aus Mähdrescherdaten, Bodenvariabilität, Zonierung für variable Applikationen.
– Schnittstellen und Datenimport/-export: APIS zu Wetterdiensten, Sensorsystemen, Agrarhandelsplattformen und Finanzsoftware.
– Mobile Apps: Einsatz auf dem Feld, offline-fähig, einfache Datenerfassung durch Mitarbeitende.
– Reporting und Controlling: Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Kalkulationen, Compliance-Reports.
– KI und Entscheidungsunterstützung: Empfehlungssysteme für Düngung, Pflanzenschutz, Bewässerung oder maschinelle Routenplanung.
– Datensicherheit und Rechteverwaltung: Verschlüsselung, Rollen- und Rechtemanagement, DSGVO-konforme Datenhaltung.
– Integration von IoT und Drohnen: Sensoren für Bodenfeuchte, Wetterstationen, Drohnen-Bilder für Pflanzengesundheit.
Diese Funktionen sind die Bausteine, nach denen Sie die Systeme bewerten sollten. Nicht jeder Betrieb benötigt alle Module – die Kunst besteht darin, die passende Kombination zu finden.
Marktüberblick: Wer bietet Farm-Management-Software an?
Der Markt ist heterogen: Vom etablierten Agrartechnik-Hersteller bis zum Start-up sind viele Anbieter tätig. Manche Lösungen sind speziell auf Ackerbau ausgerichtet, andere unterstützen Mischbetriebe inklusive Viehhaltung. Es gibt lokale Anbieter mit stark regionalem Fokus und internationale Plattformen mit umfangreichen Integrationsmöglichkeiten.
Im Grunde lassen sich Anbieter in drei Kategorien einteilen: 1) Vollintegrierte Plattformen großer Softwarekonzerne oder Hersteller, 2) Speziallösungen für bestimmte Aufgaben (z. B. Ertragskartierung oder Telematik), 3) Modular aufgebaute Systeme, die sich nach Bedarf zusammenstellen lassen. Die Wahl hängt von Betriebsgröße, Komplexität und der Bereitschaft zur digitalen Transformation ab. Für kleine bis mittlere Betriebe sind oft einfache, kostengünstige und mobile Lösungen am sinnvollsten; Großbetriebe hingegen brauchen häufig umfassendere ERP- und BI-Funktionen.
Vergleich beliebter Farm-Management-Software
Unten finden Sie eine vergleichende Tabelle (Tabelle 1), die einige marktbekannte Systeme gegenüberstellt. Die Auswahl an Features berücksichtigt Funktionalität, Integration, Benutzerfreundlichkeit, Kostenorientierung und Zielkundengruppe. Diese Tabelle soll als Ausgangspunkt dienen; prüfen Sie vor einer Entscheidung stets eine Testphase oder Demo.
Tabelle 1: Vergleich ausgewählter Farm-Management-Softwarelösungen
| # | Software | Zielgruppe | Kernfunktionen | Stärken | Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgrarCloud Pro | Großbetriebe, Lohnunternehmer | ERP-Integration, Telematik, BI, automatisierte Berichte | Skalierbar, starke Datenanalyse | Hohe Einstiegskosten, Einarbeitungszeit |
| 2 | FieldSmart | Familienbetriebe, Ackerbau | Feldmanagement, mobile App, Ertragskarten, Wetter | Einfach zu bedienen, kostengünstig, offline-fähig | Begrenzte BI-Funktionen |
| 3 | CropSense | Precision Farming Anwender | Drohnenintegration, Bildanalyse, variable Applikation | Starke GIS-Analyse, AI-gestützte Empfehlungen | Fokus auf Ackerbau, weniger Finanztools |
| 4 | FarmLedger | Bio- und Direktvermarktung, nachhaltige Betriebe | Compliance, Rückverfolgbarkeit, Lieferkettenintegration | Gute Traceability-Funktionen, Zertifikatsmanagement | Weniger Maschinenintegration |
| 5 | AgriSmall | Kleinbetriebe, Einsteiger | Grundlegende Dokumentation, Mobile App, Rechnungserstellung | Sehr günstig, intuitive Bedienung | Skalierung limitiert |
Diese Auswahl ist beispielhaft; der Markt entwickelt sich schnell. Achten Sie bei einem Vergleich auf Open-Data-Standards, API-Verfügbarkeit und lokale Supportoptionen.
Auswahlkriterien: Wie wählt man die richtige Lösung?
Die richtige Software auszuwählen ist wie die Wahl eines Traktors: sie muss zur Betriebsgröße, zum Fahrstil und zu den Aufgaben passen. Hier sind strukturierte Kriterien, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen.
Liste 1: Wichtige Auswahlkriterien (nummeriert)
- Bedarfsanalyse: Welche Prozesse sollen digitalisiert werden? Nur Dokumentation, oder auch Steuerung von Maschinen?
- Skalierbarkeit: Wächst die Lösung mit dem Betrieb? Sind Module erweiterbar?
- Integration: Unterstützt die Software Telematik, IoT, Drohnen und externe Dienste?
- Benutzerfreundlichkeit: Wie schnell können Mitarbeiter eingearbeitet werden?
- Kostenstruktur: Einmalige Lizenz, Abonnement, oder Pay-per-Use? Welche versteckten Kosten gibt es?
- Datensicherheit: Wo liegen die Daten (Cloud/On-Premise)? Wie ist die Zugriffsregelung organisiert?
- Support & Schulung: Gibt es lokalen Support, Handbücher und Schulungsangebote?
- Offline-Fähigkeit: Funktioniert die App auch ohne Mobilfunkempfang?
- Rechtliche Anforderungen: Erfüllt die Lösung Dokumentationspflichten und Zertifizierungsanforderungen?
- ROI und Wirtschaftlichkeit: Sind Einsparungen oder Ertragssteigerungen realistisch belegt?
Gehen Sie diese Punkte mit einer Gewichtung für Ihren Betrieb durch. Eine strukturierte Checkliste hilft, Anbieter objektiv zu vergleichen.
Implementierung: Schritt-für-Schritt zur produktiven Nutzung
Die Implementierung einer Farm-Management-Software ist mehr als Software-Installation; sie ist ein Veränderungsprojekt. Ein geplanter Ansatz minimiert Fehler und beschleunigt den Nutzen.
– Schritt 1: Zieldefinition und Prozessaufnahme. Welche Abläufe sind kritisch? Wer sind die Verantwortlichen? Legen Sie messbare Ziele fest (z. B. 10% Kraftstoffeinsparung, 20% weniger Überschneidungen bei Feldarbeiten).
– Schritt 2: Datenbereinigung und Basisdaten anlegen. Feldgrenzen digitalisieren, Maschinenstammdaten und Materiallisten erfassen. Oft unterschätzt, aber essenziell.
– Schritt 3: Pilotphase auf Teilflächen. Testen Sie Workflow, mobile Erfassung und Integration von Telematik in einem begrenzten Umfeld.
– Schritt 4: Schulung der Mitarbeitenden. Praktische Schulungen, Schulungsvideos und regelmäßige Refresher sind wichtig.
– Schritt 5: Rollout und Monitoring. Nutzen Sie Kennzahlen zur Erfolgskontrolle und passen Sie Prozesse iterativ an.
– Schritt 6: Kontinuierliche Optimierung. Nutzen Sie gesammelte Daten zur besseren Entscheidungsfindung und Automatisierung (z. B. variable Applikationskarten).
Liste 2: Implementierungs-Checkliste (nummeriert)
- Benennen Sie einen Projektverantwortlichen im Betrieb.
- Erstellen Sie eine Daten- und Prozesslandkarte.
- Planen Sie Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter und Management.
- Führen Sie eine Testphase mit klaren Erfolgskriterien durch.
- Bewerten Sie Schnittstellen zu bestehenden Systemen (z. B. Buchhaltung).
- Dokumentieren Sie Lessons Learned für spätere Ausweitung.
Erfolgsentscheidend ist, die Technik an die Arbeitsweise des Betriebs anzupassen — nicht umgekehrt. Kleine, sichtbare Erfolge fördern die Akzeptanz im Team.
Finanzen: Wirtschaftlichkeit und Return on Investment (ROI)
Investitionen in Farm-Management-Software sind nicht nur Kosten, sie ermöglichen Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Typische Einsparpotenziale sind reduzierter Verbrauch von Dünger und Pflanzenschutzmitteln (durch variable Applikation), geringere Maschinenlaufzeiten, optimierte Arbeitsplanung und weniger Überschneidungen oder Doppelarbeiten. Außerdem reduzieren digitale Systeme Verwaltungsaufwand und verbessern die Datenqualität für Förderanträge und Zertifizierungen.
Zur ROI-Berechnung sollten Sie folgende Parameter berücksichtigen: Anschaffungskosten (Lizenzen, Hardware), laufende Kosten (Abonnements, Support), Implementierungsaufwand (Schulungen, Datenmigration) und erwartete Einsparungen oder Mehreinnahmen. Ein realistisches Szenario könnte sein: Einsparung von 8–12% Dünger- und Pflanzenschutzkosten plus 5–10% Effizienzsteigerung bei Maschineneinsätzen — abhängig von Ausgangslage und Bereitschaft zur Nutzung.
Wichtig ist, die Zeit bis zur Amortisation zu bestimmen. Kleine Betriebe mit geringen Margen bevorzugen oft modulare, günstige Lösungen, während große Betriebe durch Skaleneffekte schnell in den grünen Bereich kommen.
Datenschutz und Datensicherheit: Wer besitzt die Daten?
Daten sind das Herz der digitalen Landwirtschaft — deswegen müssen Fragen zu Eigentum, Zugang und Sicherheit früh geklärt werden. Viele Anbieter speichern Daten in der Cloud; hier spielen Serverstandort, Verschlüsselung, DSGVO-Konformität und Rechteverwaltung eine Rolle. Prüfen Sie Verträge hinsichtlich Datenportabilität (kann ich meine Daten exportieren?), Drittzugriff (wer darf Daten sehen?) und Haftungsfragen.
Für sensible Betriebsdaten können hybride Lösungen (lokale Kopie + Cloud) sinnvoll sein. Bei Kooperationen mit Lohnunternehmern oder Lieferkettenpartnern sollten Zugriffsebenen klar definiert sein. Schließlich gilt: Gute Datenhygiene und Zugriffsmanagement reduzieren Risiken.
Praxisbeispiele: Wie Betriebe digitale Lösungen nutzen
Konkrete Beispiele zeigen, wie variabel die Anwendung sein kann. Ein 500 ha Ackerbaubetrieb könnte etwa GPS-gestützte Aussaat und variable Düngung einsetzen, dadurch Ertragsvariabilität reduzieren und Kosteneinsparungen erzielen. Ein kleiner Hof mit Direktvermarktung nutzt die FMS zur Dokumentation und Rückverfolgbarkeit, um höhere Preise durch bessere Vermarktung zu erzielen. Ein Milchviehbetrieb integriert Sensoren zur Tiergesundheit und kombiniert Futterplanung mit Betriebskostenrechnung.
Solche Fallstudien zeigen auch, dass die besten Ergebnisse oft durch Kombination von Technologien erzielt werden: Telematik für Maschinen, Drohnen für Befallsdiagnose, Sensoren für Bodenfeuchte und eine zentrale Plattform zur Koordination.
Zukunftstrends: Was kommt als Nächstes?
Die digitale Landwirtschaft entwickelt sich dynamisch weiter. Einige Trends verdienen besondere Aufmerksamkeit:
– Künstliche Intelligenz und Machine Learning: Bessere Vorhersagen für Erträge, Schädlingsbefall und optimierte Input-Mengen.
– Vernetzung und Interoperabilität: Offene Standards und APIs ermöglichen nahtlose Systeme über Betriebgrenzen hinweg.
– Robotik und autonome Maschinen: Kleine Roboter für Unkrautbekämpfung, autonome Traktoren für Nachtarbeit.
– Edge-Computing: Datenverarbeitung direkt am Feldgerät reduziert Latenz und Bandbreitenbedarf.
– Blockchain für Rückverfolgbarkeit: Transparente Lieferketten vom Feld bis zum Verbraucher.
– Nachhaltigkeitsreporting: Automatisierte CO2-Bilanzen und Öko-Zertifizierungen als Funktion der FMS.
– Plattformökonomie: Marktplätze für Agrarmittel, Lohnarbeit und Dienstleistungen integriert in FMS.
Diese Entwicklungen werden die Möglichkeiten weiter ausbauen – aber sie erhöhen auch die Komplexität, so dass Bewusstsein für Governance und Weiterbildung wichtig bleibt.
Praktische Tipps für Betriebsleiter: So holen Sie das Maximum heraus
Einige pragmatische Empfehlungen, damit die digitale Transformation nicht zur Stolperfalle wird:
– Starten Sie klein, denken Sie groß: Implementieren Sie modulweise und erweitern Sie später.
– Holen Sie das Team früh ins Boot: Mitarbeitende mitnehmen, Schulungen anbieten, Feedback einholen.
– Prüfen Sie interoperable Lösungen: Vermeiden Sie abgeschlossene Systeme, die künftige Integration erschweren.
– Dokumentieren Sie Prozesse: Digitale Tools entfalten ihren Nutzen, wenn Prozesse konsistent erfasst werden.
– Messen Sie Erfolge: Legen Sie KPIs fest (z. B. Kosten pro Hektar, Maschinenlaufzeit, Eingabemengen).
– Nutzen Sie Test- und Demo-Zugänge: Vor einer Bindung sollten Sie die Software in der Praxis testen.
– Achten Sie auf Datensicherung: Regelmäßige Backups und Notfallpläne sind Pflicht.
– Investieren Sie in Schulung: Oft ist das größte Hemmnis nicht die Technik, sondern mangelnde Routine.
Mit diesen Grundsätzen minimieren Sie Risiko und erhöhen die Chance, dass digitale Werkzeuge echten Mehrwert liefern.
Herausforderungen und Risiken
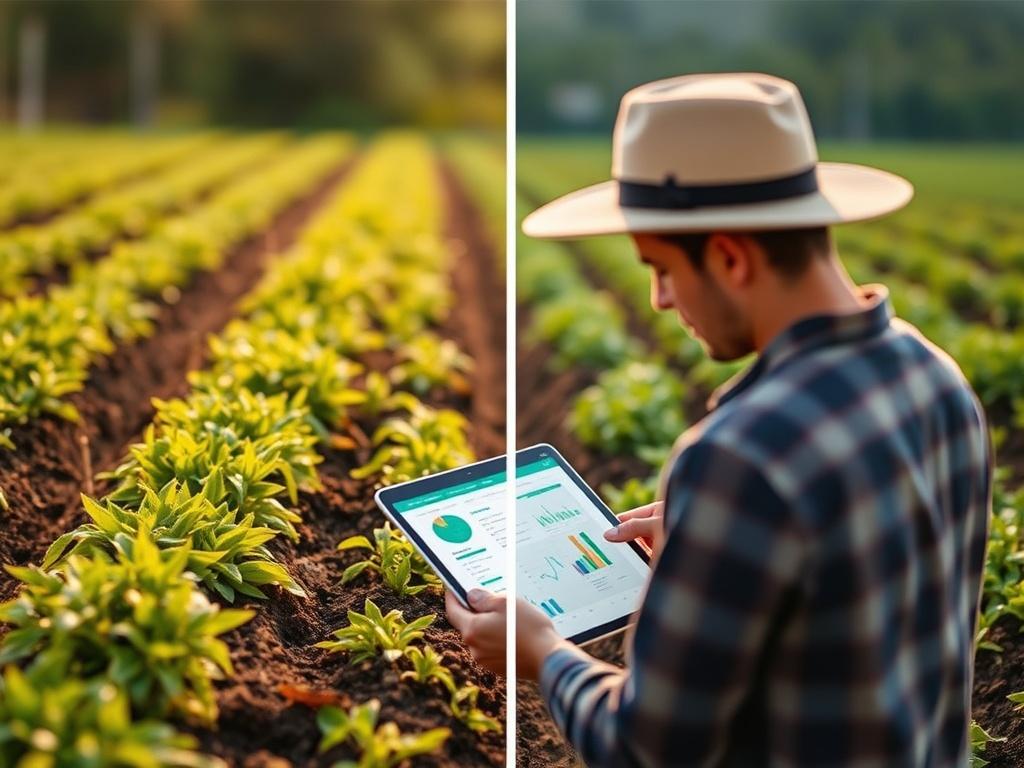
Trotz vieler Vorteile gelten auch Risiken: hohe Einstiegskosten, Abhängigkeit von Anbietern, technische Probleme (z. B. schlechter Mobilfunkempfang), Datenschutz- und Haftungsfragen sowie die Gefahr der Überinformation — zu viele Daten ohne klare Handlungsanweisungen. Außerdem besteht das Risiko, dass ohne passende Schulung die digitalen Tools nicht regelmäßig genutzt werden und somit keinen Mehrwert liefern.
Ein weiteres Problem ist die Fragmentierung von Daten: Wenn verschiedene Systeme ohne Standard kommunizieren, entsteht ein Wildwuchs an Datensilos. Hier sind offene Standards und interoperable Plattformen die Lösung.
Checkliste: 10 Fragen vor der Entscheidung
Bevor Sie sich festlegen, beantworten Sie die folgenden Fragen für Ihren Betrieb:
- Welche Ziele verfolge ich mit der Software (Zeitersparnis, Kostenreduktion, Compliance)?
- Welche Datenquellen müssen integriert werden (Maschinen, Sensoren, Drohnen)?
- Benötigen wir Offline-Funktionalität?
- Wie viel Budget steht für Anschaffung und laufende Kosten zur Verfügung?
- Wie sieht der Support des Anbieters aus (lokal, telefonisch, online)?
- Ist die Datenhoheit klar geregelt (Export, Eigentum, Löschung)?
- Gibt es Referenzbetriebe mit ähnlichem Profil?
- Welchen Schulungsaufwand kann ich leisten?
- Wie skalierbar ist die Lösung bei Betriebswachstum?
- Welche Schnittstellen zu Buchhaltung, Handelspartnern oder Behörden sind nötig?
Diese Fragen strukturieren die Auswahl und helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Praxis-Check: Ein kleines Beispielprojekt für Ihren Betrieb
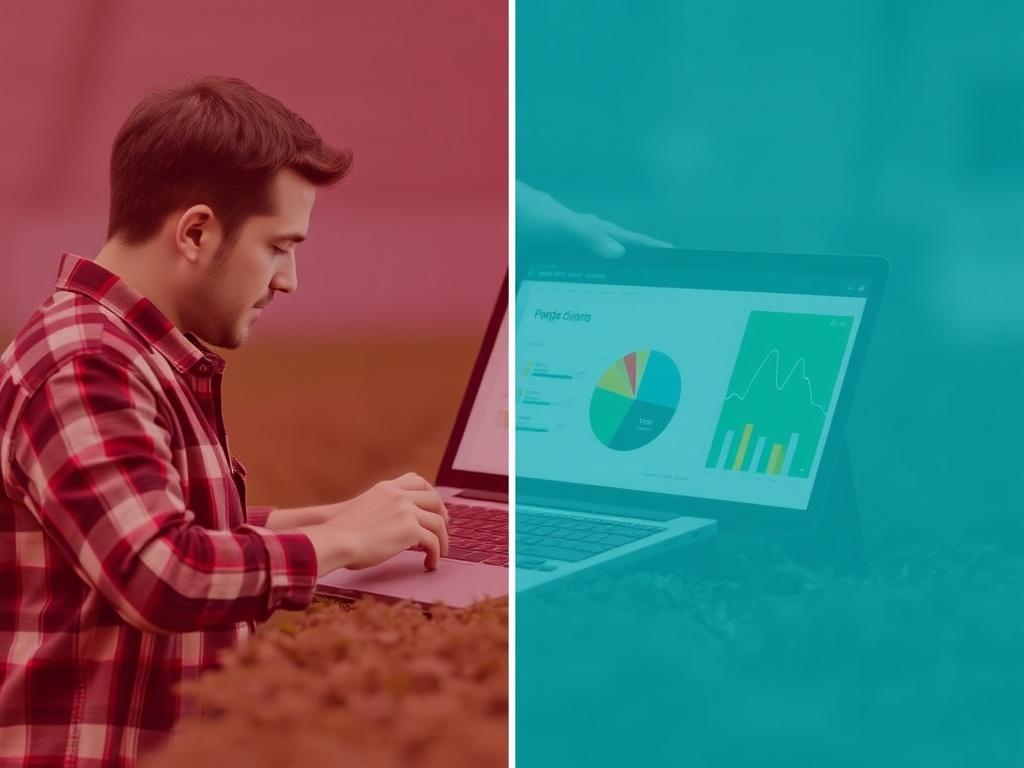
Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, empfehle ich dieses kleine Pilotprojekt, das in wenigen Monaten realisierbar ist:
– Ziel: Einsparung von 10% Dünger durch variable Applikation auf 50 ha Testfeld.
– Schritte: 1) Feldgrenzen digitalisieren, 2) Ertrags- und Bodendaten aus Vorjahren analysieren, 3) Applikationskarten erstellen, 4) Umsetzung mit Lohnunternehmer oder eigener Maschine, 5) Auswertung nach der Ernte.
– Erfolgskriterien: Messbare Reduktion des Düngemitteleinsatzes, Ertrag stabil oder verbessert, monetärer Nutzen größer als Implementierungskosten.
– Zeitrahmen: 1 Saison für Umsetzung und Auswertung.
– Ressourcen: Eine einfache FMS-Lösung mit GIS, Unterstützung durch Berater oder Anbieter.
Dieses Projekt ist überschaubar, zeigt aber den Nutzen datengetriebener Maßnahmen und bietet eine gute Erfolgsmessung für Skalierung.
Ressourcen und Weiterbildung
Digitale Landwirtschaft ist Lernfeld und Praxis zugleich. Nutzen Sie lokale Schulungsangebote, Messeauftritte, Webinare der Anbieter und Pilotprojekte. Netzwerke mit anderen Landwirten können enorm hilfreich sein: Erfahrungsaustausch beschleunigt Entscheidungen und liefert praxisnahe Tipps. Anbieter stellen oft Online-Tutorials und Support-Communities bereit — nutzen Sie diese Ressourcen intensiv.
Schlussfolgerung

Digitale Landwirtschaft und Farm-Management-Software bieten enorme Chancen: effizientere Prozesse, geringerer Ressourcenverbrauch, bessere Planbarkeit und stärkere Wirtschaftlichkeit. Die Auswahl der richtigen Lösung erfordert jedoch sorgfältige Analyse der betrieblichen Bedürfnisse, klare Ziele, eine realistische ROI-Betrachtung und solide Implementierungsplanung. Starten Sie mit überschaubaren Piloten, investieren Sie in Schulung und achten Sie auf Datensouveränität und Interoperabilität. Wer diese Punkte beachtet, kann von Precision Farming, IoT, KI und vernetzten Systemen nachhaltig profitieren und seinen Betrieb resilienter und zukunftsfähiger aufstellen.
Оценивайте статью, делитесь материалом с друзьями в социальных сетях, а также высказывайте свое мнение в обсуждении ниже! ![]()








